
Modellbahn
Tricks &Tipps

|

|
Modellbahn
|

|
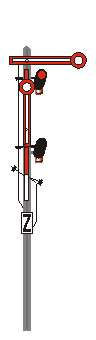 Planung
PlanungFachkenntnisse erwerben
Fußboden
Systemauswahl
Tipp: - Lassen Sie sich Zeit!
Tipp: - Planen Sie autonome Teilabschnitte!
Tipp: - Beachten Sie die Zugänglichkeit!
Tipp: Planen Sie die Zuglängen
Resultat
Nachfolgeanlage
WDP-Projekt-2010
Raumbeleuchtung
Jeder der eine Modellbahn bauen will, hat schon irgendwelche Vorstellungen, wie sie mal aussehen sollte. Wer völlig neu anfängt - das sind den Fachhändlern die liebsten Kunden, weil die alles gebrauchen können -, sollte sich aber gründlich informieren, was es so am Markt für Möglichkeiten gibt.
Meine Kenntnisse stammen zum Einen aus dem "Märklin
Magazin", das natürlich etwas "Hersteller-lastig" ist, aber zumindest im
Landschaftsbau viele neutrale Tipps bereit stellt. Dabei ist es im
Grunde nicht notwenig (aber natürlich erstrebenswert), die Zeitschrift
zu abonnieren. Sechs komplette Jahrgänge habe ich für je 5 Euro
bei Ebay ersteigert und mit Ausnahme neuester Steuerungstechnik ist noch
alles aktuell.
Allerdings hat es mich etwas "genervt", dass hier mit aller Gewalt
immer wieder Rücksicht genommen wird, möglichst viele (teure)
Produkte von Märklin u.a. zu verkaufen. So wird - als ein Beispiel - überhaupt
nicht auf eine moderne Steuerungstechnik hingewiesen mit Computer etc.,
weil das die Central Station eben weitgehend überflüssig machen würde.
Also - nehmen Sie nicht alles für bare Münze, was da empfohlen wird!
Um später die einzelnen Beiträge wieder finden zu können, habe ich mir parallel beim Lesen ein kleines Inhaltsverzeichnis geschrieben. Wenn Sie selbst das "MM" zur Verfügung haben, können Sie es vielleicht gebrauchen:
Aufgrund der "Hersteller-Lastigkeit" habe ich allerdings
meine Märklin Insider-Mitgliedschaft zum Ende 2006 gekündigt und das
neue "Dreileiter-Magazin" abonniert, das viele hilfreiche Tipps enthielt
- dem aber leider auch kein langes Leben beschieden war.
Dafür habe ich dann mal wieder ein paar Jahrgänge vom MM bei ebay ersteigert.......
Eine weitere wichtige Wissensquelle ist die Newsgruppe:
http://www.stummiforum.de/
in der jeder auch komplizierte Fragen stellen und schnell Antworten erhalten kann.
Nun ja, und natürlich das Internet mit seinen
Herstellerseiten ebenso wie mit vielen Beschreibungen von privaten und
Vereinsanlagen.
Portale wie:
führen zu einer Fülle von Anregungen. Wenn Sie alle die Webseiten von Moba-Enthusiasten lesen wollen, sind Sie wochenlang beschäftigt.
.....und in diesem Informationswust wird wohl auch diese Homepage untergehen! Aber es macht ja Spaß, solch eine Seite zu bauen.
Eine sehr gut, "konventionelle" Quelle waren mir noch die
ausgezeichneten Bücher von Bernhard Stein "Modellbahnanlagen und
Dioramen" sowie "H0-Modellbahn-Anlagen". Wenn ich
darin blättere, komme ich mir immer "ganz klein" vor, denn hier schreibt
ein echter Meister! Solch eine Bauqualität und -kunst werde ich wohl nie
hinkriegen (und Sie wahrscheinlich auch nicht.
![]() !)
!)
Den folgenden Hinweis hat mir ein netter Leser geschrieben. Ich gebe ihn mal weiter:
Wählen Sie als Fußboden niemals Laminat (Holz, Stein). Es
muss etwas sein, das sich leicht reinigen lässt, möglichst weich ist, sich nicht
elektrisch auflädt, schalldämmend und warm ist. Die beste
Wahl dazu ist Kork. Den gibt es in Platten oder ähnlich wie
Laminatbretter und das Material lässt sich recht einfach verlegen.
Nachdem meine Nachfolgeanlage schon längst im Rohbau stand, habe ich den Teppichboden rausgerissen und den Raum mit 10mm Presskork verlegt. Die Platten muss man vollflächig verkleben, sonst wölben sich die Kanten hoch. Nur durch die losen Platten war es möglich, unter den Modellbahnfüßen einen neuen Boden aufzubringen.
Spürbar leiser ist es wohl nicht geworden, aber Fegen ist halt einfacher als Staubsaugen und im Winter dürften kalte Füße eher die Ausnahme sein. Vor allem ist das Material recht weich für den Fall, dass mal trotz Absturzsicherung etwas runterfällt.
Wechselstrom oder Gleichstrom? H0, N, Z oder 1? Diese Entscheidung müssen Sie selbst treffen vor dem Beginn der Gleisplanung und ich werde mich hüten, hier Empfehlungen zu geben!
Allerdings hatte ich als Kind eine Märklinbahn und als "Middle-Ager" (mit 30-35 Jahren) einen Mix aus Lima, Roco und anderen Gleichströmern. Von der zweiten Bahn sind mir noch die dauernde Kontaktprobleme in Erinnerung, so dass jetzt nur das Dreileiter-System und damit Märklin in Frage kam. Damit ist es auch am einfachsten, Rückmelder zu installieren, denn dass die ganze Anlage mit modernster Computersteuerung ausgestattet werden sollte, war von Anfang an klar. Bei der Vorgängerbahn hatte ich eine Steuerung mit 60 vielpoligen Telefonrelais realisiert. Das funktionierte zwar beeindruckend und es war richtig spannend, dem Relaisklappern zuzusehen, aber den Drahtverhau wollte ich nun nicht wiederholen.
Blieb noch die Entscheidung ob K- oder C-Gleis:
Für
dauerhaften Aufbau mit Einschotterung ist sicher das preiswertere
K-Gleis eine gute Wahl - vor allem auch durch die Möglichkeit der Flex-Gleise.
Für häufiges Auf- und Abbauen auf dem Fußboden
passt das C-Gleis besser, und auch die Fertigungspräzision dieses
Systems ist ausgezeichnet.
Bei der 3. Bahn hatte ich mich für das K-Gleis
entschieden.
Aufgrund der doch häufigen Kontaktprobleme, mit denen ich zu kämpfen
hatte, wurde es für die 4. Anlage dann das C-Gleis, so dass ich mit beiden Systemen Erfahrungen sammeln konnte..
Wer vor einer ähnlichen Entscheidung steht, ob er nun das K- oder das C-Gleis nehmen soll, kann ja mal diese Ausarbeitung lesen:
Die Planung sollte natürlich auch nicht mit dem
Zeichenstift erfolgen - eine Methode, mit der ein normaler Sterblicher wirklich keine
optimalen Gleispläne hinbekommt.
Ich verwendete die Gleisplanungssoftware von
Wintrack - noch in der Version 6.0 und
kann dieses Programm sehr empfehlen. Es ist ausgereift und bietet
unglaublich viele Möglichkeiten. Es lohnt sich unter allen Umständen,
sich mit dem Programm intensiv zu beschäftigen, um die rudimentär im
Kopf spukenden Ideen in einen funktionierenden Gleisplan umzusetzen.
Inzwischen gibt es schon Nachfolge-Versionen und auch Märklin bietet
diese Software als "offizielles Gleisplanungsprogramm" an.
Schattenbahnhöfe/Bahnhöfe/Ausweichgleise:
Die Länge des kürzesten Ausweichgleises bestimmt
naturgemäß die Länge des längsten Zuges. Aufgrund
der Raumgröße kam ich zu einer Mindestlänge von 1,71m,
was zu einer maximalen Zuglänge von etwa 1,55m führte. Da die
Außengleise einer Gleisharfe immer um die Länge einer Weiche
länger sind als die Mittengleise, kann ich mit viel
Steuerungstechnik auch ein paar Güterzüge mit 1,72 m
Länge fahren lassen. Mehr war nicht möglich. Achten Sie
darauf, dass möglichst alle Ihre Abstellgleise gleich lang sind!
 Ich habe nachträglich
im unteren Schattenbahnhof neben den 5 Gleisen noch weitere 5+1
Stumpfgleise gebaut. Mit meiner Steuerungstechnik fahren die Züge sehr
schön rückwärts aus und in den eigentlichen Schattenbahnhof ein. Die
Gleise dienen also dem "temporären Aus-dem-Verkehr-ziehen" von
verschiedenen Zuggarnituren, was andere Kollegen mit einer Vitrine
erledigen. Bei mir muss möglichst immer alles auf den Gleisen stehen,
und nach ein paar Tagen kommen die Züge nach und nach wieder zum
Vorschein. So ist immer Abwechslung gegeben.
Ich habe nachträglich
im unteren Schattenbahnhof neben den 5 Gleisen noch weitere 5+1
Stumpfgleise gebaut. Mit meiner Steuerungstechnik fahren die Züge sehr
schön rückwärts aus und in den eigentlichen Schattenbahnhof ein. Die
Gleise dienen also dem "temporären Aus-dem-Verkehr-ziehen" von
verschiedenen Zuggarnituren, was andere Kollegen mit einer Vitrine
erledigen. Bei mir muss möglichst immer alles auf den Gleisen stehen,
und nach ein paar Tagen kommen die Züge nach und nach wieder zum
Vorschein. So ist immer Abwechslung gegeben.
Wenn man rückwärts rangieren muss und sogar mit längeren Zügen, sollten
die Gleise allerdings 2-3% Gefälle haben, um das Entgleisen zu
verhindern.
Ziemlich spät, als fast die ganze Landschaft im Hintergrund schon fertig war, fiel mir auf, dass mein ursprünglicher Plan mit einer Drehscheibe und einem Ringlokschuppen nichts taugt. Aus Platzgründen könnte nur ein dreiständiger Schuppen gebaut werden und dazu passt eben keine große Drehscheibe. Statt dessen wird der Platz nun für eine Menge Abstellgleise und eine Großbekohlungsanlage mit funktionsfähigem Kran vorgesehen.
Als späteres Projekt war noch ein großer zehngleisiger Schattenbahnhof unter der Anlage geplant. Darauf könnten entsprechend lange Züge parken und nach und nach aus- und wieder eingeschleust werden. Auch diese Planung geschah also sozusagen nach "Redaktionsschluss" der eigentlichen Planungsphase und zum Bau dieses großen Schattenbahnhofs ist es dann nicht mehr gekommen.
Das Programm "Wintrack" hat als sehr wertvolle Hilfe eine Kontrolle über die maximale Rampensteigung und eine Höhenkontrolle. Eine Steigung von 3 bis maximal 4% sollte auf den Hauptstrecken mit den langen Zügen nicht überschritten werden. Kurze Züge auf bergigen Nebenstrecken schaffen auch 5%. Natürlich sind geringere Steigungen besser - meist lassen die Platzverhältnisse aber keine Wahl.
Wenn allerdings zu den Steigungen auch noch Kurven hinzu kommen, kommt man schnell an Grenzen:
Eine Kurve mit Radius R1 (R=360 mm) darf nicht mehr als 3% Steigung
aufweisen, wenn lange Züge fahren sollen. Geht man über diese
Grenze hinaus, passiert es immer wieder, dass starke Loks die Wagen
langer Züge nach innen aus den Kurven reißen und alles nach
unten fällt. Das passiert bei mir bei Zügen ab 2,50 m
Länge. Planen Sie also Gleiswendeln so, dass Sie entweder
einen Radius R2 verwenden können oder machen Sie aus einem Kreis
durch zwei gerade Gleisstücke ein Oval mit flacherer Steigung.
Als minimalen vertikalen Abstand zwischen den einzelnen
Ebenen im nicht sichtbaren Bereich habe ich 80mm angesetzt
einschließlich 5mm Schaumauflage. Für die Züge bleibt
also nur eine lichte Höhe von 75mm bei Ausschnitthöhen von
90mm (Zugabe von 10mm für das Trassenbrett). Wenn es ganz eng
wird, liegt das obere Gleis auch schon mal ein paar Zentimeter frei, wo unten der Zug durchfährt..
Um Oberleitungsstromabnehmer zu schonen, setzt man, wo es notwendig ist, ein dünnes Alu-Blech
als "Niederhalter" ein.
Bei Parallelgleisen setzt das Planungsprogramm einen normalen Gleisabstand fest, der so gewählt ist, dass in Kurven sich keine Wagen mit den Zügen des Nachbargleises berühren können. Dieser Gleisabstand ist nach meiner Meinung für gerade Bahnhofsdurchfahrten zu groß und sollte um 1 bis 2 cm verkleinert werden. Dadurch passen Fußgängerbrücken, Reiterstellwerke etc. besser über die Parallelgleise.
 Das ist ein ganz wichtiger Hinweis!:
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis!: Ein
Jahr später war dann der nächste Bauabschnitt dran mit einer Verdopplung
der Gleise.
Ein
Jahr später war dann der nächste Bauabschnitt dran mit einer Verdopplung
der Gleise.
Ich persönlich "muss" immer dann, wenn ich intensiv eine Zeit lang gebaut habe, erst wieder ein paar Runden fahren und die Abläufe verbessern....... Das macht viel mehr Spaß!
Auch das sollte unbedingt beachtet werden:
Die Tiefe der Anlage sollte nicht mehr als 1,70m sein, wenn sie von
beiden Seiten aus zugänglich ist. Falls es irgendwie möglich ist,
sollte man zusätzliche Mannlöcher einplanen, die einfach zu öffnen
sind und sowohl in der Bauphase als auch bei späteren Gelegenheiten
(Entgleisungen, Detailarbeiten etc.) einen leichten Zugang auf alle Teile der Anlage ermöglichen.
Ich habe z. Bsp. ein großes Mannloch im hinteren rechten Teil der Anlage, dessen Platte ich dadurch entnehme, dass ein echter Felsstein mit einem Dübel von unten verbolzt ist. Damit kann ich die Platte samt Ferienbungalow fest anfassen und hoch nehmen. Und unter der Platte hat sie eine Öse und die Wand dahinter einen Haken und so hängt der Bungalow bei Wartungsarbeiten eben an der Wand!

 Die Fugen ringsum das Mannloch werden durch Hecken, Bäume und Häuser so
kaschiert, dass praktisch nichts von der Konstruktion zu sehen ist.
Die Fugen ringsum das Mannloch werden durch Hecken, Bäume und Häuser so
kaschiert, dass praktisch nichts von der Konstruktion zu sehen ist.
Planen Sie unbedingt von Anfang an solche Mannlöcher mit ein!
Wichtig ist auch die lichte Höhe tieferer Gleise zur nächst höheren Ebene:
Wenn nur ein Gleis über dem anderen liegt oder sich zwei Gleise
kreuzen oder man durch Greiflöcher in den Randspanten an das Gleis
heran kommt, kann man bis auf 7 cm lichte Höhe zurückgehen.
Wenn man aber in einem mehrgleisigen Schattenbahnhof über vordere
Gleise hinweg greifen muss, braucht man mindestens 20cm Platz nach
oben, sonst "bricht man sich die Finger".
Das sollte man bei der Gleisplanung also berücksichtigen!
Im Übrigen wird man natürlich beim Bau von hinten nach vorn und von unten nach oben arbeiten, so dass man bei Spantenbauweise immer zwischen die noch offenen Spanten krabbeln kann.
Die Bergspitzen habe ich abnehmbar gestaltet und im Landschaftsbau als erstes fertig gestellt. Es ist eben viel einfacher, den ganzen Berg auf den Basteltisch zu legen und wie ein Diorama erst fertig zu stellen, bevor er endgültig mit der Anlage verbunden wird. Zwischen den beiden Dioramen und der Art der Gestaltung der Felsen liegen zwei Jahre Bastelerfahrung.....
Und so sieht nun das Ergebnis der Planung der ersten Anlage in der Theorie aus:
|
||
|
|
|
|
|
|
Wintrack Datei "Anlage.zip" |
||
Nachdem ich ich die dritte Anlage (s.o.!) fertig gestellt hatte,
wurde sie verkauft, um Platz für die vierte zu schaffen.
Ein bisschen Verrücktheit muss sein, oder?
Die vierte Anlage sollte natürlich nun mit der
geballten Erfahrung aus den letzten Jahren gebaut werden, und schon die
Planung ging deutlich schneller, erfolgte aber dennoch gründlicher
als vorher. Der grundlegende Unterschied sollte vor allem in der Wahl
des Gleissystems (jetzt C-Gleis) liegen und im Aufbau "immer an der
Wand entlang". Damit erreicht man sehr lange Paradestrecken in einem
vorgegebenen Raum - allerdings um den Preis, dass man nie die ganze
Anlage auf einmal sieht, weil ringsherum überall Züge fahren
und man hinten höchstens Hühneraugen hat ![]() . (Aber dafür gibt es später dann die "Belastungssteuerung!")
. (Aber dafür gibt es später dann die "Belastungssteuerung!")
Die vier Wände des Raumes bekamen also vier Module und diese
sollen zur Not auch wieder trennbar sein - man kann ja nie wissen!
Jedes Modul stellt eine Art eigens Thema dar:
Betriebswerk - mit Drehscheibe, die bei der vorigen Anlage aus Platzgründen leider entfallen musste. Auch die Großbekohlungsanlage wird wieder eingesetzt.
Bahnhof mit vielen langen Gleisen und ein wenig Industrie.
Mittelgebirge mit langen Strecken, oben drauf eine Berg-Nebenbahn und tief drin ein großer Schattenbahnhof
"Hochgebirge" mit dem großen Bietschtal-Viadukt verbunden
Es wurde natürlich zuerst der Gleisplan gezeichnet, dann das
WDP-Gleisbild dazu und dann alle Fahrstraßenabschnitte mit
Rückmeldern. Es stand somit von Anfang an ziemlich fest, wie viele
Rückmelder und Module zum Einsatz kommen (zuerst 26 Module, von denen immer
je zwei Kontakte als Reserve frei gehalten werden!), und ich konnte
bei der Vergabe der Rückmeldekontakte den Startkontakten späterer
Fahrstraßen "markante" Nummern zuweisen, damit ich sie mir im
Fahrbetrieb später besser merken kann.
Auch das ist wichtig!
Das Ganze wurde wesentlich vereinfacht durch eine umfangreiche Excel-Tabelle. Da der Spantenaufbau schon klar war und die zu bauenden Gleise, konnte ich auch abschätzen, wieviele Rückmelder wo benötigt wurden. Durch die Tabelle war dann auch klar, an welchen Spanten welche RM-Module anzuschrauben waren, um möglichst unnötig lange Meldeleitungen zu verhindern.
Und in gleicher Weise wurden die Magnetartikel (Weichen Signale und andere) geplant und die Decoder entsprechend über die Anlage verteilt.
Außerdem stieß ich bei dieser Art der "Feinplanung" im Vorfeld auf eine Fülle von Fehlern in Gleisplan und Gleisbild, die man natürlich am Anfang viel leichter korrigieren kann, als das später der Fall gewesen wäre.
Das sieht Ganze dann so aus, nachdem im Jahre 2017 noch ein weiterer Schattenbahnhof hinzu kam:
|
|
||
Projekt-2017.tra |
 Noch
ein paar Worte zu diesem Thema, denn Ihre Bahn soll ja schön und
blendfrei "in Szene" gesetzt werden:
Noch
ein paar Worte zu diesem Thema, denn Ihre Bahn soll ja schön und
blendfrei "in Szene" gesetzt werden:
Ich selbst habe mir für meine erste Anlage einen Strahler von 500 Watt unter die Decke geschraubt in der Überlegung, dass die Sonne schließlich auch eine punktförmige Lichtquelle ist und die dann entstehenden Schatten sehr realistisch aussehen müssten. Das ist auch richtig so, allerdings muss ich zwei Einschränkungen machen:
Der Strahler sitzt direkt über dem Steuerpult. Die Wärmeabstrahlung ist zumindest spürbar und zwar nicht schlimm aber auch nicht unbedingt angenehm.
Wenn man an der Platte steht, wirft man selbst einen deutlichen Schatten, steht sich also selbst im Licht.
Besser wäre es wohl gewesen, den Strahler seitlich, zum Beispiel über der Eingangstür zu platzieren.
Jürgen Herberger macht auf seiner
Lokwelt-Seite
noch einen anderen, interessanten Vorschlag, der mir noch sinnvoller
zu sein scheint.
Damit hat man natürlich immer "bedeckten Himmel" an der Bahn, aber
der soll ja in Deutschland nicht ganz so selten sein.
Die rot gezeichnete Blende ist innen mit Alu-Folie kaschiert, um die Lichtausbeute zu verbessern.